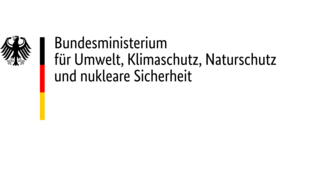Ein ausgewachsener Kaffeebohrer misst lediglich zwischen 1,2 und 1,9 Millimeter. Der Schaden, den er verursacht, ist dafür umso größer. Mehr als 500 Millionen US-Dollar jährliche Einnahmeeinbußen durch befallene Kaffeeplantagen gehen auf das Konto des kleinen Schädlings. Auch in OroVerdes KlimaWald-Projektregionen treibt der Käfer sein Unwesen. Die gute Nachricht: Es gibt Möglichkeiten, den Befall zu reduzieren.
Ein geschulter Blick auf die unzähligen kleinen grünen Kaffeekirschen an den Ästen der Kaffeepflanzen offenbart Kaffeebäuer*innen schnell, ob sich ein Kaffeekirschenbohrer (Hypothenemus hampei) eingenistet hat. Denn ein winziges braunes Loch am Ende der Kaffeekirsche ist der Eingang zum Paradies für den geflügelten Käfer. Namensgebend bohrt sich das Weibchen in das Innere der Kaffeefrucht. Darin legt sie bis zu 120 Eier. Einmal geschlüpft, frisst ihr Nachwuchs die Bohnen komplett auf und vermehrt sich darin.
Äußerlich ähnelt der Kaffeebohrer einem Borkenkäfer und ist kein neues Phänomen auf Kaffeeplantagen. Der Käfer stammt aus Zentralafrika und ist mittlerweile in allen Kaffeeanbauländern dieser Welt zu Hause. Anfang des 20. Jahrhunderts gelang der Kaffeebohrer durch den internationalen Kaffeehandel nach Brasilien und von dort aus verbreitete er sich in ganz Süd- und Zentralamerika – auch auf Hispaniola, wo der Käfer heute den haitischen und dominikanischen Kaffeebäuer*innen in den KlimaWald-Projektregionen das Leben schwermacht.
Natürliche Insektizide mindern Ausbreitung

Dort findet der Kaffeebohrer ideale Bedingungen. Er bevorzugt hohe Luftfeuchtigkeit, die in der Dominikanischen Republik und Haiti keine Seltenheit sind. Besonders auf Kaffeeplantagen mit dicht zusammenstehenden älteren Kaffeepflanzen fühlt er sich wohl. Oft werden sogenannte Hotspots in bestimmten Reihen und Senken beobachtet, die besonders stark befallen sind. Denn der Kaffeebohrer lebt und vermehrt sich auch in heruntergefallenen Bohnen. Regnet es, verlassen nur die fliegenden Weibchen die Bohne und suchen sich einen anderen Standort. Studien haben gezeigt, dass sie bis zu 500 Metern weit fliegen können.
Der Kaffeebohrer ist deshalb sehr mobil und kann Grundstückgrenzen einfach überfliegen. So gelangt er auch in weniger dicht bepflanzte Agroforstsysteme, wie bei OroVerdes Projektpartnerorganisation Centro Naturaleza. Befallene Kaffeepflanzen in Agroforstsystemen haben aber trotzdem einen großen Vorteil zu konventionellen Plantagen. Denn unter Schattenbäumen ist auch der Pilz Beauveria bassiana vermehrt zu Hause. Er wirkt als natürliches Insektizid und mindert so die Ausbreitung des Käfers. Außerdem wird in Agroforstsystemen der Bodenerosion vorgebeugt, die Bodenqualität und die Artenvielfalt gefördert. Natürliche Fressfeinde der Kaffeebohrer wie Vögel oder andere Insekten tragen ebenfalls zu einer natürlichen Schädlingsbekämpfung bei, wie eine kürzlich veröffentlichte Studie des CATIE-Instituts zeigt (Martínez-Salinas et al. 2019).
Intakte Ökosysteme sind widerstandsfähiger
Eines der KlimaWald-Projektziele ist es, Ökosysteme systematisch zu stärken. Dabei ist der Ansatz, naturnahe Landwirtschaft zu etablieren. Zum Beispiel durch Agroforstsysteme, die eine waldähnliche Struktur haben und in denen eine chemische Schädlingsbekämpfung nicht notwendig ist. So werden bisher landwirtschaftlich genutzte Flächen teilweise renaturiert und trotzdem können Kleinbäuer*innen ein Einkommen auf ihren Grundstücken erwirtschaften.
Intakte Waldökosysteme sind widerstandsfähiger und regulieren sich auf natürliche Weise. Das heißt zum Beispiel, dass Auswirkungen des Klimawandels wie Hitzewellen in Wäldern weniger dramatische Folgen für die Bodenflora- und fauna haben als auf landwirtschaftlich genutzten Flächen. Die Extremtemperaturen werden durch das Mikroklima im Wald abgeschwächt. Mehr Organismen überleben die Hitze und der Wald kann sich schneller erholen.
Das Projekt ist Teil der Internationalen Klimaschutzinitiative (IKI). Das Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMUKN) fördert die Initiative aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestags.